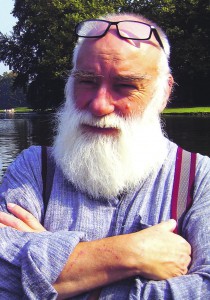 Ich bin ein langsamer Leser, und so habe ich mich seit meinem Geburtstag nächtens Seite um Seite durch die „Tagebücher 2002-1012“ von Fritz J. Raddatz „geackert“, manchmal zum Missvergnügen meiner Frau, die meinte, das Buch könne man doch auch abends statt morgens gegen eins oder drei lesen. Nein, sagte ich, abends sei ja noch Arbeitszeit, in der Nacht aber hole mich die senile Bettflucht ein. Neben Raddatz, das hätte ihm sicher gefallen, lag Peter Huchels letzter Gedichtband, den er noch in Händen halten durfte, „Die neunte Stunde“.
Ich bin ein langsamer Leser, und so habe ich mich seit meinem Geburtstag nächtens Seite um Seite durch die „Tagebücher 2002-1012“ von Fritz J. Raddatz „geackert“, manchmal zum Missvergnügen meiner Frau, die meinte, das Buch könne man doch auch abends statt morgens gegen eins oder drei lesen. Nein, sagte ich, abends sei ja noch Arbeitszeit, in der Nacht aber hole mich die senile Bettflucht ein. Neben Raddatz, das hätte ihm sicher gefallen, lag Peter Huchels letzter Gedichtband, den er noch in Händen halten durfte, „Die neunte Stunde“.
Beides also Werke, die sich intensiv mit dem Tod beschäftigte, mit der endgültigen „Nacht“ also, die dem Menschen dräut. Beides in ihrer Art radikale Werke. Raddatz, einst stellvertretender Cheflektor im Verlag „Volk und Welt“, nach seiner Flucht 1958 aus der DDR wurde er 1960 stellvertretender Chef des Rowohlt-Verlags, schließlich von 1977 bis 1985 Feuilletonchef der „Zeit“. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung definiert er die Zumutung des Alters als den „rapide auf Null gehenden Neugierpegel. Beim Zeitunglesen erwische ich mich bei dem Gedanken: kenn ich, weiß ich, brauche ich nicht.“ Aber er weiß auch: „Wenn es einem selber bevorsteht, in die Grube zu fahren, ist man wieder Analphabet.“ Weite Teile seines Tagebuches setzen sich damit auseinander. Wobei für Raddatz immer klar ist, dass die Gedanken an den Tod das Leben nicht vergällen, sondern intensivieren.
Er hat mich beim Lesen „erwischt“. Wenn er erzählt, dass sich im Alter die Träume verändert haben, er eher Dinge aus der Vergangenheit träumt, manchmal ganze Handlungsstrecken wiedergeben kann, kann ich das seit einiger Zeit nachempfinden. Fast datumsgetreu könnte ich sagen, wann sich die Träume bei mir plötzlich, in genau dieser Weise, natürlich mit anderem Personal als bei Raddatz, verändert haben. Ich nahm es sofort wahr, ohne es mit dem Alter in Verbindung zu bringen. Vieles ähnelt sich: „Mein Telefonbuch ist voll mit Toten. Andauernd stirbt jemand.“ So Raddatz in der Süddeutschen. „Würde ich ein neues Telefonbuch anlegen, wäre es hostiendünn.“
Auf Huchel kommt er zuweilen auch zu sprechen, den ehemaligen Chefredakteur der „Sinn und Form“, der, wie Raddatz, die DDR verließ. Er besuchte ihn, „ohne je wirklich Zugang zu dem knöchern-verschlossenen Mann – mir gegenüber vielleicht auch misstrauisch? – zu finden. „Einst fliege ich auf / zu den Gazellen des Lichts / sagt eine Stimme.“ Der einzige hoffnungsvolle Vers aus den wie aus Stein geschlagenen Gedichten des Bandes „Die neunte Stunde“ steht auf der Umschlagrückseite als Auszug aus dem Gedicht „Pfeilspitze des Ada“. Tatsächlich richtungweisend? Das sagen mir diese wie hermetisch wirkenden Gedichte nicht. „Unbewohnbar die Trauer / die an den Klippen verebbt.“ („Schottischer Sommer“). „Der Geruch des Todes machte mich blind.“ („Der Ammoniter“). Huchel starb 1981, zwei Jahre, nachdem der Band bei Suhrkamp erschien. Raddatz nahm am 26. Februar 2015 in der Schweiz die Sterbehilfe in Anspruch. Er hatte die Freude an der heutigen Literatur verloren. Vor allem aber die Neugier, er sagte es ja selbst. Hinzu kam die Angst vor dem Verfall, dem „öffentlichen Sterben“, wie er es bei Rühmkorf oder Kempowski mit Entsetzen verfolgt hatte.
Ist es vermessen, dass der „langsame Leser“ ausgerechnet in der Weihnachtszeit über den Tod nachdenkt? Aber ist diese hektische Betriebsamkeit, diese sinnentleerte Einzelhandelsorgie nicht eine Art Tod? Als ich mit Schülern kürzlich Weihnachtsgeschichten schreiben wollte, saß da ein Junge recht traurig und brachte nichts auf das Papier. Ich setzte mich zu ihm und erfuhr von dieser tiefen Weihnachtstraurigkeit, die drohende Reise zu den Großeltern, bei denen man sittsam um den Tisch sitzen und warten musste, bis der Geschenkeverteiltermin nahte, um sich dann freuen zu müssen und aufzuatmen, wenn man endlich wieder gehen kann. „Das ist so langweilig,“ Ein Schüler, dem jetzt schon die Neugier abhanden gekommen ist. Kein Ort. Nirgends. Da ist keine Freude mehr. „Das Fest der Familie“. Was bin ich froh, dass, um mal wieder mit Gerald Wolf zu sprechen, mir das Gottes-Gen nicht abhanden gekommen ist. Gerade zu diesem Fest spüre ich da wieder meine Wurzeln, die mich den Körper strecken lassen, die mir eine tiefe Vorfreude erzählen, die mir in die Zeit hineinreden, denn in keinem der letzten dreißig Jahre war es so wichtig, die Kirche in ihrer Herkunft von einem Flüchtlingskind zu entdecken. Und, ja, der Tod. Nein, ich warte nicht auf ihn. Noch spüre ich genügend Neugier in mir. Aber, sagte ich kürzlich jemandem, der sich nach meinem Befinden erkundigte: Was soll passieren? Selbst wenn ich gehen muss, gehe ich doch nur nach Hause. Das so sagen zu dürfen, pardon, liebe naturwissenschaftlich Verwaisten, betrachte ich nach wie vor als Geschenk, weil es mich in zwei Richtungen wappnet: Als mein Schwiegervater in diesem Jahr starb, sagte er: „Ach, ich kann euch nicht erzählen, was ich alles sehe.“ Da ist ein Zuhause. Aber die andere Richtung ist die ins Leben: Gleichfalls eher von Hoffnung als von Ängsten umstellt, aber einer Hoffnung, die hellsichtig macht, die Wege aufzeigt, wo die „Verteidiger des christlichen Abendlandes“ in der Hölle ihrer Angst schon in diesem Leben schmoren. Raddatz geht mir nahe, weil dieser brillante Kopf in zwei Richtungen denkt: Da ist der Tod nur Übel und Schrecknis. Gleichzeitig aber schreibt er auch angesichts dieser permanenten Auseinandersetzung mit dem Feind großartige Essays, feinsinnige Bücher, als Monumente des Lebens gegen das gewitterte Vergessen nach dem Ableben. Gegenstemmen statt erleiden. Auch freilich endlich bar aller Hoffnung. Vielleicht der einzige Punkt, an dem ich mich reibe. Auch dafür war ich ihm dankbar, dass er diese Tagebücher hinterlassen hat, ziemlich ungeschminkt. Aber zu empfehlen!
